Weißt du, was mich beim Zeichnen am meisten frustriert hat? Wenn ich das, was ich sah, nicht 1:1 aufs Papier bringen konnte. Mit dem „Original“ hatte mein Werk manchmal recht wenig Ähnlichkeit: Mal stimmten die Größenverhältnisse nicht, ich übersah etwas oder zeichnete etwas, was in Wirklichkeit gar nicht da war.
Ich kann es beweisen, denn ich habe ein Skizzenbuch nach dem anderen damit gefüllt.
Damit du weißt, was ich meine, habe ich ein Beispiel für dich. Bei Schuhen ist das noch undramatisch. Die sehen, auch wenn sie krumm und schief sind, lustig und nett aus.

Ganz anders ist das bei Häusern. Und so saß ich einmal weinend in einem Perspektiven-Workshop, weil ich verzweifelt und am Ende erfolglos versuchte, ein Gebäude in der richtigen Perspektive aufs Papier zu bringen. Obwohl ich die Theorie verstanden hatte, wollte mir die Umsetzung aufs Papier einfach nicht gelingen.
Wie man perspektivisch richtig zeichnet, kann man lernen. Es gibt einen Fluchtpunkt und Hilfslinien. Damit und mit ein bisschen Übung führt das zu recht ordentlichen Ergebnissen.
Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es beim Zeichnen nicht darum geht das, was man sieht, 1:1 aufs Papier zu bringen.
Eine Zeichnung ist eine persönliche Interpretation dessen, was ich sehe.
Nicht mehr und nicht weniger.
Perfektion anzustreben ist eine sinnfreie Angelegenheit und by the way auch nicht das Ziel des Zeichnens.
Spaß hat mir das Zeichnen immer dann gemacht, wenn ich aus einem inneren Impuls heraus zu Farbe und Pinsel griff. Dann gefiel mir das Ergebnis, auch wenn es krumm und schief war.
Sobald ich mich mit anderen verglich oder den Anspruch hatte, das Motiv möglichst perfekt aufs Papier zu bringen – also den Fokus aufs Ergebnis hatte – sank mein Selbstbewusstsein in den Keller.

Ich bin einfach kein van Gogh und ich werde nie sein Niveau erreichen. Zumindest nicht, solange Zeichnen ein Hobby ist. Das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Das war auch nie das Ziel. Es führte lediglich dazu, dass ich zwanzig Jahre lang glaubte, nicht zeichnen zu können und mich damit völlig blockierte.
Beim Zeichnen habe ich immer einen Vergleich.
Entweder mit dem Motiv selbst, oder mit anderen, die das Motiv ebenfalls zeichnen.
Beim Schreiben gibt es keinen Vergleich!!!
Jeder Text ist einzigartig.
Bewusst wurde mir das erst, als ich das Buch von Benedict Wells las.
Bisher hatte ich mich nach allen Regeln der Schreibkunst abgemüht, möglichst zügig veröffentlichungsreife Blogtexte zu schreiben. Ich meine, nichts anderes wird einem erzählt: Recherchiere, mache Zwischenüberschriften und dann fülle den Rest mit Text. Alles easy. Zumindest hatte ich den Eindruck.
Dass ich mich damit in schöner Regelmäßigkeit mitten in die Schreibblockade manövrierte, wurde mir kürzlich bewusst, ich habe im Blogartikel „Von der Schreibblockade zum Schreibflow: Der Weg zu meiner ganz persönlichen Schreibstrategie“ darüber geschrieben.
Benedict Wells schreibt von seinen jahrelangen mühevollen Schreibprozessen, von katastrophalen und frustrierenden Rückmeldungen und von vielen Absagen. Er hätte unendlich viele Gründe gehabt, aufzugeben. Hat er aber nicht.
Das zu erfahren, hat auch die letzten Begrenzungen, die ich noch im Kopf hatte, weggesprengt.
Es war so beruhigend.
Wenn sich ein erfahrener Autor immer noch mit dem Schreiben herumgequält, kann ich es auch noch schaffen. Und dann erklärt er viele Seiten später,
dass es DIE Schreibstrategie überhaupt nicht gibt.
Denn jeder Autor, jede Autorin entwickelt über die Jahre seine ganz eigene Herangehensweise ans Schreiben.
Manche Autoren haben gleich zu Beginn den ganzen Plot samt allen Figuren im Kopf und dann gibt es Krimiautoren, die zu Beginn noch keine Ahnung haben, wer der Mörder ist. Weil sich die ganze Geschichte erst während des Schreibens entfaltet.
Wow! Und noch eine Vorstellung, die gehen darf.
Ich erkenne, dass Schreiben eine Entdeckungsreise in ein unbekanntes Land ist, oder wie Natalie Goldberg in ihrem Buch „Wild Mind“ schreibt:
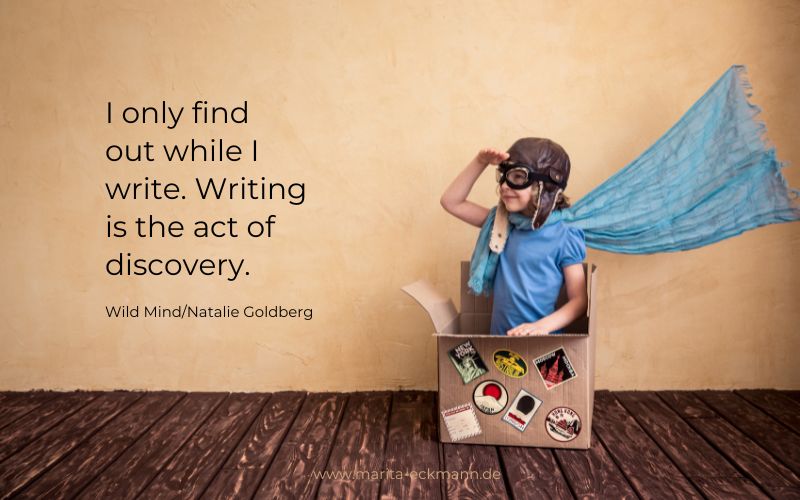
Sie hat recht, ich hatte es nur noch nicht gesehen, weil ich die gut gemeinten Regeln und das Ergebnis so sehr im Fokus hatte, dass ich mich nicht mehr auf den Schreibprozess einlassen konnte.
Ich hatte noch nicht verstanden – nein falsch – ich hatte nicht wahrgenommen, dass sich auch meine Texte erst während des Schreibens entwickeln.
Doch, ich hatte es wahrgenommen, denn ich bin immer wieder überrascht und finde es auch total spannend, dass ich am Anfang noch keine Ahnung vom fertigen Text habe. Allerdings hatte ich es nicht als „meine Art des Schreibens“ verortet.
Es erleichtert mich so sehr, dass es DIE eine und einzige Schreibstrategie nicht gibt.
Sondern, dass jeder seinen ganz persönlichen und einzigartigen Weg zum fertigen Text finden muss.
Schreiben ist ein ganz persönlicher Weg der Entfaltung. Der Sichtbarmachung dessen, was in uns ist.
Jetzt ist klar, dass sich manche Blogartikel fast von selbst schreiben, während andere monatelang im Entwurfsstatus verbringen, um am Ende völlig umgeschrieben oder vielleicht sogar gelöscht zu werden. Warum sich Schreiben manchmal leicht anfühlt und dann wieder wie das Erklimmen des Mount Everest ohne Sauerstoffflasche.
Und dass wir nie wissen, was wir während des Schreibens entdecken und welcher Text am Ende entsteht.
Dass wir uns für nichts verurteilen müssen.
Im Gegenteil: wir sollten uns für alles, was wir während des Schreibens bei uns selbst entdecken, feiern!
Selbst für sehr veröffentlichungserfahrene Autoren, kann das Schreiben eines neuen Buches wieder schwer sein. Weil auch dieses Buch noch nie geschrieben wurde. Weil alles neu und alles anders ist. Es ist immer eine Entdeckungsreise in ein neues, unbekanntes Land.
Für mich sind das sooo gute Nachrichten!
Natürlich werde ich weiterhin von den Tipps und Erfahrungen anderer lernen. Aber ich weiß jetzt, dass es deren Weg ist und nicht meiner. Es ist wie ein Buffett, von dem ich mir das Passende nehmen kann, um daraus, und aus dem Schreiben selbst, meine eigene Schreibstrategie zu entwickeln.
Übrigens ging es mir beim Zeichnen lernen ähnlich. Ich hatte bewusst keine Zeichenkurse gemacht, weil ich nicht lernen wollte, wie es „richtig“ ist, sondern meiner Kreativität Ausdruck geben wollte. Am Ende war es das Buch „The The Creative License: Giving Yourself Permission to Be the Artist You Truly Are“ von Danny Gregory, das meine „Ich-kann-nicht-zeichnen-Blockade“ gesprengt hat.
Man muss nur lange genug dranbleiben, dann findet sich der Weg schon.
















Wenn das Ergebnis deines „im Schreibflow seins“ sich so liest, liebe Marita, dann kann ich dir nur aus vollem Herzen und Halse zurufen: „GO WITH THE FLOW!“ meine Liebe.
Es liest sich, oder besser vielleicht, genießt sich, wie ein köstlicher Freundschaftsbecher mit ganz viel frischen Früchten an einem heißen Sommertag.
i LIKE!!
Liebe Sabine,
Du findest immer sooo schöne Worte. I like it!!!
Ich danke Dir
Marita
Liebe Marita,
ich halte es heute mal kurz und knapp. Da Du bei mir voll ins schwarze getroffen hast.
Ich habe mich in vielem, bzw. sehr vielem wiedergefunden und ich kann Dir nur sagen. Du bis meine Inspiration und wenn ich mal wieder an mir zweifel, was oft zu oft kommt, dann lese ich einfach bei Dir.
Danke dafür.
Liebe Grüße Elke
Wow! Das ist toll und ich freue mich darüber. Auch, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, mir einen Kommentar zu schicken.
Einen Tipp habe ich noch: Sei schneller als der innere Zweifler oder Kritiker. Das funktioniert auch gut.
Liebe Grüße und fröhliches Schreiben!
Marita
Um den Zeichenkurz kam ich beim Fotodesign-Studium nicht drum rum. Was soll ich sagen – mein Fluchtpunkt wäre im Nachbarraum gelegen. Da hilft all die graue Theorie nicht – und die Diskussion mit dem Dozenten schon gar nicht, auch wenn´s sehr lustig war – , man muss einen eigenen Weg finden, um das was man ausdrücken möchte, aufs Papier zu bringen. Beim Schreiben habe ich nach wie vor keine feste Herangehensweise, es fließt einfach plötzlich und dann gibt´s kein Halten mehr. Da kommt es sogar vor, dass ich an zwei Beiträgen parallel arbeite, weil das Hirn fast überläuft. Solange die Finger noch hinterher kommen, ist alles gut 😄
Liebe Grüße!
Du hast Fotodesign studiert???? Ich beneide Dich darum. Wirklich! Ich finds cool, dass die Texte einfach so aus Dir herausfließen. Ab und an ist das bei mir auch so. Noch zu selten, aber ich bin auf dem Weg.
Liebe Grüße,
Marita